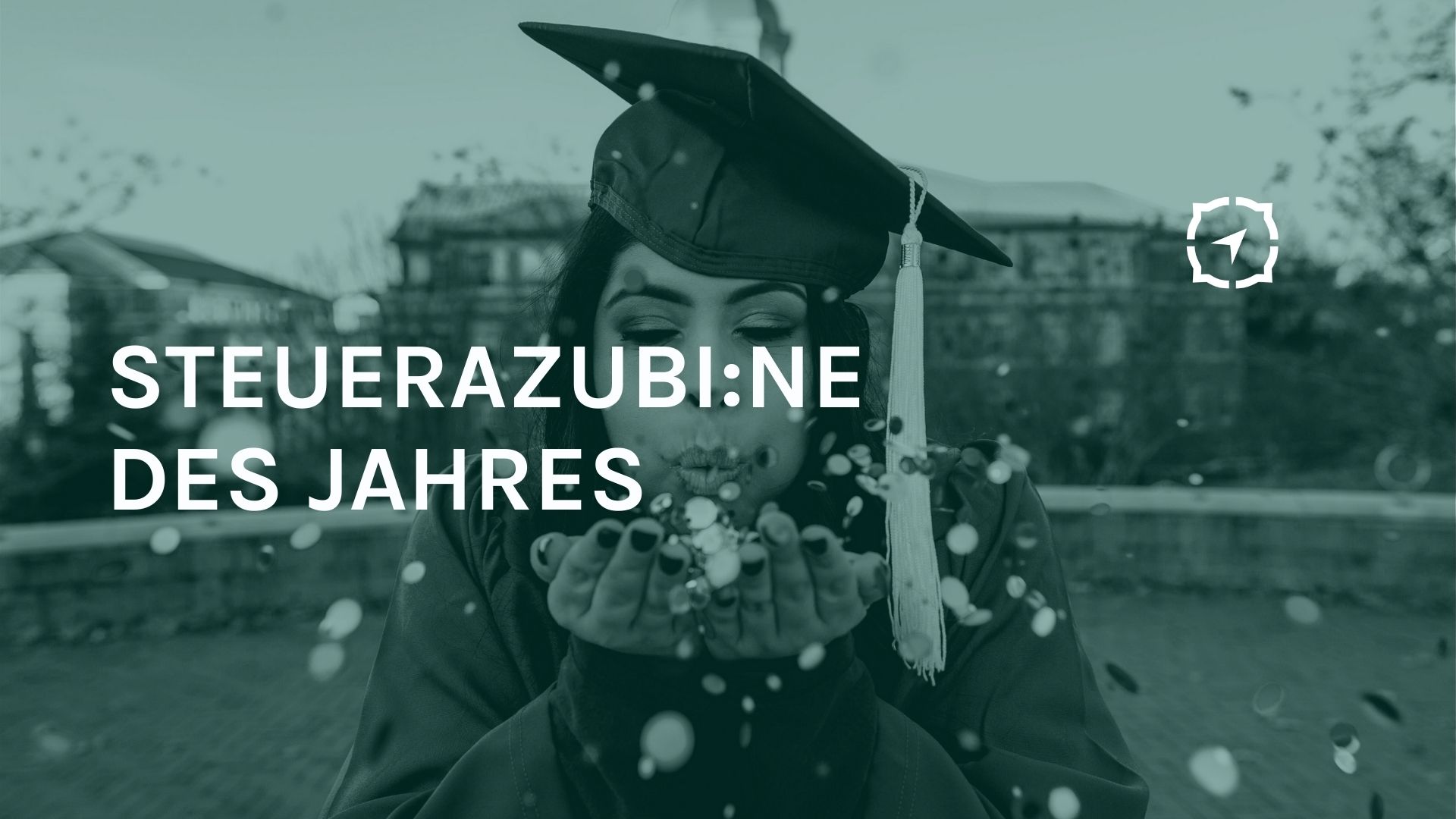Die gesetzliche Krankenversicherung
In diesem Artikel möchte ich erklären, wozu es eine Krankenversicherung gibt, wie sie sich finanziert, wer die Träger sind und nicht zuletzt, welche Leistungen man von der Krankenkasse zu erwarten hat. Dabei gehe ich auch auf die Umlagen und das Krankengeld ein. Am Ende des Textes findest du eine prüfungsrelevante Zusammenfassung für die Zwischen- und Abschlussprüfung in Wirtschafts- und Sozialkunde oder Allgemeiner Wirtschaftslehre.
Wozu gibt es eine Krankenversicherung?
Geschichtlich gesehen hat die Entstehung einer Krankenversicherung mit dem Arbeitsbedingungen um 1800 rum zu tun. 8-Stunden-Schichten und ein Jugendarbeitsschutzgesetz gab es nicht.
Kinder arbeiteten von Montag bis Samstag in Minen und gingen Sonntags zur Kirche und in die Sonntagsschule. Erwachsene arbeiteten rund 16 Stunden am Tag und wurde jemand verletzt, fiel er der Familie zur Last.
Der damalige Reichskanzler Bismarck hat dafür gesorgt, dass 1883 die Krankenversicherung, ein Jahr später die Unfallversicherung und damit das Grundgerüst der Sozialversicherung in Deutschland eingeführt wurden. Ab 1889 gab es die ersten Züge einer Rentenversicherung, gefolgt von der Arbeitslosenversicherung mit Gründung in 1927 und anschließend der Pflegeversicherung in 1995. Eine private Krankenversicherung gab es übrigens bereits ab 1843.
Der Sinn hinter der Sozial- und Krankenversicherung ist, dass die Menschenrechte unter allen Umständen gewährleistet sind. Niemand soll unter seiner Würde leben und zugleich ein Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit haben.
Wird ein Mensch krank, erkrankt beispielsweise an Krebs, kosten die Behandlungen EUR 60.000,00 – 160.000,00 pro Jahr (Laut Tagesspiegel, Angaben v. 2007).
Allein um sich die günstigste Krebsbehandlung leisten zu können, müsste man EUR 5.000,00 netto im Monat verdienen – nur um die EUR 60.000,00 zusammenzukriegen. An Miete, Ernährung oder Heizung ist dabei nicht zu denken.
Der Sinn der Krankenversicherung ist es, jedem Menschen ein Leben zu ermöglichen, auch mit einer „teuren“ Krankheit. Wirtschaftlich gesehen ist das mindestens so super wie menschlich: Eine gute Gesundheitsversorgung hilft uns, lange fit genug für die Arbeit zu sein. Und erwerbstätige Menschen bringen Geld für den Staat. Sie kurbeln die Wirtschaft an und die freie Marktwirtschaft kann nur wachsen, wenn nach Vollbeschäftigung gestrebt wird. Natürlich ist das nicht erreichbar, aber je weniger Pflegebedürftige, Behinderte und Arbeitslose es gibt, desto besser für die Wirtschaft.
Ebenfalls toll für die Wirtschaft: Viel Nachwuchs. Kinder sind die Zukunft der Wirtschaft. Ohne Kinder heute gibt es keine Steuerzahler morgen.
Wenn du dich jetzt fragst, wie sich die Krankenversicherung das leisten kann, habe ich hier ein einfaches Beispiel für dich:
Angenommen, 100 Personen zahlen EUR 100,00 monatlich in die Krankenkasse ein. Dann verdient die Krankenversicherung EUR 10.000,00 im Monat. 80 Personen haben keine ernsthafte Krankheit und bezahlen nur ihre Beiträge.
15 Personen brauchen hier und da Medikamente in diesem Monat, das kostet die Krankenkasse pro Person EUR 100,00. Es bleiben noch EUR 8.500,00 übrig. Davon kann man sich vielleicht eine Sachbearbeiterin, die Miete einer kleinen Filiale und die Behandlung eines Krebspatienten leisten. Die Krankenkasse kommt bei EUR 0,00 oder einem kleinen Plus heraus.
Aber das ist in diesem Beispiel irrelevant – denn bei 71.154.000 Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung (Bundesministerium für Gesundheit, Stand 1. April 2016) in Deutschland ist das kleine Plus eine sehr große Zahl.
Jetzt weißt schon schonmal, wozu es eine Krankenversicherung gibt und wie sie grob gesehen funktioniert.
Wer ist verpflichtet, eine Krankenversicherung abzuschließen?
Die gesetzliche Krankenversicherung ist eine Pflichtversicherung. Jeder muss eine Krankenversicherung haben.
Davon gibt es natürlich einige Ausnahmen, denn Beamte oder Arbeitnehmer, deren Gehalt die Jahresarbeitsentgeltgrenze übersteigt, sind von der Versicherungspflicht befreit.
Das heißt nicht, dass diese Menschen ohne Krankenversicherung leben können – sie dürfen sich privat versichern.
Die Jahresarbeitsentgeltgrenze ist keine Bemessungsgrundlage. Sie ist die Grenze, ab welchem Einkommen man sich privat versichern lassen kann.
Eine Krankenversicherung muss jeder deutsche Staatsbürger haben. Für Arbeitslose übernimmt das Arbeitsamt die Zahlungen, für Kinder gibt es die Familienversicherung über die Eltern (übrigens auch bei Ehepartnern) und bei Menschen im hohen Alter deckt die Rente die Krankenversicherungsbeiträge ab.
Allgemein kann sich jeder aussuchen, wo er sich versichern lässt. Ausnahmen hiervon sind besondere Gruppen:
- Studenten – sie sind grundsätzlich bei der Krankenversicherung für Studenten versichert
- Rentner – für sie gibt es die Krankenversicherung der Rentner
- Künstler und Journalisten – die Künstlersozialkasse tritt an Stelle eines Arbeitgebers.
Zwischen welchen Kassen man sich entscheiden kann, erkläre ich dir im nächsten Abschnitt über die Träger der Krankenversicherung.
Wer ist Träger der Krankenversicherung?
Die Träger der sozialen, gesetzlichen Krankenversicherung sind die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland. Dazu gehören:
- AOK
- BARMER GEK
- BKK Mobil Oil
- DAK Gesundheit
- Debeka BKK
- Deutsche BKK
- Knappschaft Bahn-See
- IKK classic
- pronova BKK
- R u V BKK
- Techniker Krankenkasse
Träger der privaten Krankenversicherung sind unter anderem die ARAG, Allianz, Debeka, Signal Iduna, HUK-Coburg, Barmenia, Axa und die „Deutsche Krankenversicherung“.
Wie hoch sind die Beiträge zur Krankenversicherung?
Die Krankenversicherung finanziert sich prinzipiell von den Beiträgen der Versicherten. Auch Zuzahlungen der Versicherten bei erhaltenen Leistungen gehören zur Finanzierung der Krankenversicherung.
Die Beitragshöhe wird regelmäßig angepasst und wird zu einer Hälfte vom Arbeitgeber, zur anderen Hälfte vom Arbeitnehmer getragen.
Die Künstlersozialkasse KSK verhält sich bei Künstlern wie Ballettlehrern, Musikern oder Bildhauern, die keine Steinmetze sind, wie ein Arbeitgeber. Dort bezahlt der Versicherte nicht den gesamten Beitrag alleine.
Der derzeitige Beitragssatz der Krankenversicherung beträgt mömentan 14,6%. Aber keine Krankenkasse empfindet diesen Anteil des Bruttogehaltes als ausreichend – zur vollständigen Finanzierung der Krankenversicherung müssen Zusatzbeiträge her. Die betragen in der Regel circa 1%.
Der Zusatzbeitrag wird allein vom Arbeitnehmer getragen.
Die AOK erhebt beispielsweise im Jahr 2016 einen Zusatzbeitrag von 0,3% in Sachsen-Anhalt, 0,8% in Niedersachsen und 1,1% in Bayern.
Ein Arbeitnehmer, der bei der AOK Niedersachsen versichert ist und EUR 1.700,00 monatlich verdient, muss davon 15,4 % (14,6 % + 0,8 %) an seine Krankenversicherung abführen. Davon wird die Hälfte des Beitragssatzes, also 7,3%, vom Arbeitgeber getragen.
7,3 % von EUR 1.700,00 sind EUR 124,10, die der Arbeitgeber auf das Bruttogehalt „obendrauf“ zahlen muss.
Dem Arbeitnehmer wird zu den EUR 124,10 zusätzlich noch ein Zusatzbeitrag von EUR 13,60 vom Bruttogehalt abgezogen. Er bezahlt also indirekt EUR 137,70 an seine Krankenversicherung AOK Niedersachsen.
Der Zwillingsbruder dieses Arbeitnehmers wohnt in Bayern. Er erhält ebenfalls EUR 1.700,00 monatlich und sein Arbeitgeber zahlt, ebenso wie der Arbeitnehmer, EUR 124,10 monatlich als Beitrag an die Krankenkasse. Doch die AOK Bayern erhebt einen Zusatzbeitrag von 1,1 %. Also wird aus den EUR 13,60, die der niedersächsische Bruder als Zusatzbeitrag von seinem Gehalt abgeführt bekommt, ein Betrag von 1,1 % * EUR 1.700,00 = EUR 18,70.
Zwei Arbeitnehmer, die ein identisch hohes Gehalt bekommen, haben auf ihrem Kontoauszug ein anderes Nettogehalt stehen, wohnen sie in unterschiedlichen Bundesländern.
Aber auch die verschiedenen Krankenkassen erheben unterschiedliche Zusatzbeiträge:
- BARMER GEK: 1,1 %
- BKK Mobil Oil: 0,8 %
- DAK Gesundheit: 1,5 %
- Debeka BKK: 0,9 %
- Deutsche BKK: 1,1 %
- Knappschaft Bahn-See: 1,3 %
- IKK classic: 1,4 %
- pronova BKK: 1,2 %
- R u V BKK: 1,0 %
- Techniker Krankenkasse: 1,0 %
Die jeweils aktuellen Zusatzbeiträge kannst du auf krankenkasseninfo.de nachlesen.
Bei den Beitragssätzen für die Krankenkasse gibt es zwei Besonderheiten:
Es gibt den ermäßigten Beitragssatz und die Beitragsbemessungsgrenze.
Wie die Namen schon sagen, deckeln diese beiden Besonderheiten die Zahlung an die Krankenkasse in zweierlei Richtungen. Wer mehr verdient als die Beitragsbemessungsgrenze, bezahlt nicht immer weiter einen prozentualen Anteil des Gehaltes an die Krankenversicherung. Der ermäßigte Beitragssatz befreit den Pflichtversicherten von zu viel finanzieller Belastung.
Der ermäßigte Beitragssatz beträgt 14,0% (Stand 2016). Das gilt für Versicherte, die keinen Anspruch auf Krankengeld besitzen (§ 243 SGB V). Das gilt für Arbeitslose, Hausfrauen und Hausmänner, aber auch für Selbstständige.
Aber auch die Studenten haben einen besonderen Beitragssatz: Wenn ein Student nicht mehr bei seinen Eltern familienversichert ist und diese Option auch nicht durch eine Heirat besteht, muss sich auch ein Student versichern. Auch, wenn
- ein Nebenjob mehr als EUR 450,00 oder
- eine Selbstständigkeit mehr als EUR 405,00 (kein Tippfehler!)
bei familienversicherten Studenten bringt, müssen von den Einnahmen, die über diese Grenze hinaus gehen, Sozialversicherungsbeiträge abgeführt werden.
Da Studenten hauptberuflich studieren und man Studenten unterstützen möchte, gibt es die einheitliche Beitragshöhe von EUR 61,01, die nicht-familienversicherte Studenten an die Krankenversicherung bezahlen. Dabei spricht man vom studentischen Grundbeitrag – er wird an die studentische Krankenkasse abgeführt.
Dazu kommen noch ein jeweiliger Zusatzbeitrag und die Pflegeversicherung – und so werden monatlich etwa EUR 75,00 vom Konto des Studenten abgebucht. Eine Verrechnung mit einem Bruttogehalt funktioniert hier natürlich nicht.
Die Beitragsbemessungsgrenze beträgt derzeit EUR 4.125,00 monatlich (EUR 49.500,00 im Jahr). Zum Vergleich: Noch vor 5 Jahren in 2011 lag die Beitragsbemessungsgrenze für die Krankenversicherung etwa bei EUR 3.700,00.
Ein Arbeitnehmer verdient EUR 1.420,00 monatlich. Seine Krankenkasse erhebt einen Zusatzbeitrag von 1,0 %. Für den Arbeitnehmer fallen also 8,3 % Abgaben des Bruttogehalts an. Das sind EUR 117,86.
Verdient der Arbeitnehmer EUR 4.125,00 monatlich und ist bei derselben Krankenkasse versichert, führt er noch immer 8,3% an die Krankenkasse ab. Das sind in absoluten Zahlen EUR 342,38.
Verdient der Arbeitnehmer EUR 4.130,00 im Monat, so zahlt er noch immer EUR 342,38 an die Krankenversicherung. Die EUR 5,00, die er mehr verdient als die Beitragsbemessungsgrenze, sind sozialversicherungsfrei.
Bei einem Bruttoverdienst von beispielsweise EUR 7.500,00 sind noch immer EUR 342,38 fällig.
Vertausche nicht die Beitragsbemessungsgrenze und die Arbeitsentgeltgrenze. Allgemein gesagt ist die Arbeitsentgeltgrenze die Grenze, ab welcher man sich privat versichern kann. Private Versicherungen nehmen generell bevorzugt vermögende, gutverdienende und gesunde Menschen an, kurzum:
Versicherte, die mehr Geld einspielen als beanspruchen.
Die Arbeitsentgeltgrenze beträgt derzeit EUR 4.575,00.
Was ist das Umlageverfahren?
Bekommt ein Arbeitnehmer (AN) ein Bruttogehalt, so sind in diesem die Arbeitnehmer-Anteile der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung enthalten. Die Arbeitgeberanteile müssen vom Arbeitgeber zum Bruttogehalt zusätzlich gezahlt werden. Das, was auf dem Konto des AN landet, ist das Bruttogehalt ohne die Arbeitnehmeranteile, die an KV, RV, AV und PV abgeführt werden. Lohnsteuer und Kirchensteuer werden direkt (monatlich) an das Finanzamt bezahlt. Der Arbeitgeber muss zusätzlich zu den Arbeitgeberanteilen Umlagen bezahlen.
Die Beitragssätze zum Umlageverfahren (U1 und U2) werden individuell von den Krankenkassen festgelegt. Bei der Umlage 1 (U1) handelt es sich um Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und bei der Umlage 2 (U2) um Mutterschaftsaufwendungen.
Am Umlageverfahren U1 müssen Arbeitgeber teilnehmen, dei nicht mehr als 30 Arbeitnehmer haben. Zu den Arbeitnehmrn zählen keine Auszubildenden und Aushilfskräfte. Diese Zahl der Arbeitnehmer setzt sich zusammen aus den Arbeitnehmern, die an acht Monatsersten des Vorjahres im Betrieb gearbeitet haben. Teilzeitkräfte sind nur anteilig zu berücksichtigen.
Zwei Teilzeitkräfte arbeiten 50 %, also 20 statt 40 Stunden und eine Teilzeitkraft arbeitet 75 %, also 30 von 40 Arbeitsstunden in der Woche. Gemeinsam ergibt sich eine Anzahl von 1,75 Arbeitnehmern. Ungerade Zahlen sind erlaubt!
Am Umlageverfahren U2 müssen hingegen alle Arbeitgeber teilnehmen – auch die Arbeitgeber, die ausschließlich Männer beschäftigen, obwohl die Umlage 2 nur Umlagen im Zusammenhang mit einer Mutteschaft beinhaltet. Das hat zwei Gründe. Erstens sind Männer, wie man aus dem Biologieunterricht wissen sollte, maßgeblich daran beteiligt, dass Frauen zu Schwangeren und anschließend zu Müttern werden können. Und zweitens darf man Arbeitgeber nicht von der Umlage 2 entlasten, wenn sie nur Männer beschäftigen – das würde die ohnehin ungleichberechtigten Chancen von Frauen auf dem Arbeitsmarkt mindern.
Erstattungsfähige Aufwendungen der U1 sind die Aufwendungen, die aus Anlass der Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers (incl. Steuerabzüge, Sozialversicherungsbeiträge und vermögenswirksame Leistungen) ergeben. Die Anwendung erfolgt im Gegensatz zur Arbeitnehmer-Berechnung auch für Aushilfen und Auszubildende.
Die erstattungsfähigen Aufwendungen der Umlage U2 sind solche, die aus Anlass der Mutterschaft der Arbeitnehmerin entstanden sind. Dabei handelt es sich um den Zuschuss zum Mutterschaftsgeld (max. 13 Euro täglich) innerhalb der Fristen gem. MuSchG. Insgesamt sind dazu 14 Wochen vorgesehen: 6 Wochen vor dem geplanten Entbindungstermin und 8 Wochen danach. Bei Zwillingsgeburten gilt ein Beschäftigungsverbot für die frischgebackene Mutter von 12 Wochen nach der Geburt.
Bei der Umlage 2 werden 100% der Aufwendungen erstattet. Unter’m Strich trägt der Arbeitgeber keine Kosten.
Im Krankheitsfall der Arbeitnehmer, von welchen die entstandenen Aufwendungen durch die Umlage U1 abgedeckt wird, werden dem Arbeitgeber mindestens 40%, maximal aber 80% der Kosten erstattet. Jede Krankenkasse gibt 3 – 4 Erstattungssätze an. Der Arbeitgeber darf sich diese selbst aussuchen und nach dem Krankenstand und seiner Schätzungen, was sich lohnt, entscheiden.
Die AOK Bayern bietet 2016 beispielsweise folgende Sätze an:
- U1_1: 2,2 % Beitragssatz (monatliche Zahlung des Bruttoarbeitslohns), 70 % Erstattung im Krankheitsfall
- U1_2: 1,8 % Beitragssatz und 60 % Erstattungssatz
- U1_3: 3,3 % Beitragssatz und 80 % Erstattungssatz
- U1_4: 1,3 % Beitragssatz und 50 % Erstattungssatz
Für die Umlage U2 bietet diese Krankenversicherung exemplarisch einen Beitragssatz von 0,46 % an.
Die Beitragssätze der Umlagen werden jeweils nach dem gewählten Prozentsatz der jeweiligen Krankenkasse vom RV-Brutto (Rentenversicherungsbrutto, ohne Einmal-Bezüge) aller Arbeitnehmer erhoben. Für die Ergebung der Umlage U2 sind auch kurzfristig Beschäftigte von Bedeutung.
Was muss eine gesetzliche Krankenversicherung leisten?
Für den Pflichtversicherten ist womöglich am interessantesten, welche Leistungen einem die Krankenkasse erbringen kann. Jeder weiß wohl, dass Ärzte Geld verdienen müssen. Genauer gesagt verdienen Ärzte sogar richtig gutes Geld.
Bei einem Kassenarzt bezahlt allerdings niemand minutengenau abgerechnet ein Honorar in bar. Genauer: Es bezahlt kein Patient seinen Arzt.
Damit beziehe ich mich ausschließlich auf ärztliche Behandlungen, die zu den Heilbehandlungen zählen. Zahnprothesen und Schönheitsoperationen (kosmetische Eingriffe) zählen also nicht hierzu.
Die Krankenkasse bezahlt also unseren Hausarzt. Aber das ist nicht alles: Es gibt Präventionskurse, Sportkurse, Zuschüsse für bestimmte Freizeitaktivitäten der Versicherten und diverse Zuzahlungen für Krankenhausaufenthalte, Medikamente und Hilfsmittel.
Um einen Überblick über diesen Dschungel der Leistungen der Krankenversicherung zu bekommen, möchte ich sie in sechs Kategorien einteilen:
- Sach-, Dienst- und Geldleistungen
- Gesundheitsförderung und Prävention
- Untersuchungen, Früherkennung
- Behandlung von Krankheiten
- Krankengeld
- Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschutz
Zu den Sachleistungen, Dienstleistungen und Geldleistungen gehören die wohl bekanntesten Leistungen der Krankenversicherung. Die Krankenkasse bezahlt prinzipiell
- benötigte Medikamente
- Krankenhausbehandlungen
- ärztliche Behandlung
- Krankengeld
- Mutterschaftsgeld
Dabei sind Medikamente und die Krankenhausbehandlungen Sachleistungen, die ärztliche und zahnärztliche Behandlungen sind Dienstleistungen und Kranken- sowie Mutterschaftsgeld zählen zu den Geldleistungen.
Ein sehr intelligenter Grundgedanke erklärt, warum die Krankenversicherung heutzutage mehr als jemals zuvor für die Prävention ihrer Versicherten tut: «Medikamente und Behandlungen sind teurer als das Vorbeugen der Krankheit!»
Also bemüht sich die Krankenversicherung massiv um die Gesundheitsförderung und Prävention. Dazu zählen Kurse, an denen die Versicherten kostenlos teilnehmen können, Ermäßigungen für die Mitgliedschaft in Fitnessstudios oder auch Aktionen.
Die Kosten einer Lungenkrebsbehandlung sind deutlich geringer als die Kosten für einen Lehrgang zum Thema Rauchentwöhnung oder das Aufbauen einer Selbsthilfegruppe.
Die Geschäftsräume der einzelnen Krankenversicherungen sind voll von Informationen und Flyern über Aktionen und Präventionskurse zum Thema gesundes Leben. Dabei soll erreicht werden, dass sich jeder Mensch mehr bewegt und weniger Giftstoffe zu sich nimmt.
Eine gesunde, ausgewogene Ernährung wird beispielsweise in von der Krankenkasse finanzierten Kochkursen gefördert. Das beugt beispielsweise Bluthochdruck, Fettleibigkeit und Diabetis Typ II vor. Die Kosten der Untersuchungen, Behandlungen und eventuell sogar der krankheitsbedingten Arbeitsausfälle sind nicht nur für die Krankenversicherung immens.
Auch Arbeitgeber und die anderen Versicherungen der Sozialversicherung sind daran interessiert, dass Arbeitnehmer so gesund und produktiv wie möglich sind.
Vorbeugen ist also besser als heilen – nicht nur für die Krankenversicherung und den Arbeitgeber, sondern natürlich auch für den Versicherten. Wer gesund lebt und nicht krank wird, fühlt sich womöglich insgesamt gesünder als jemand, der ungesund lebt, krank war und sich nun durch Medikamente an ein gesundes Level angleicht.
Auch Schutzimpfungen wie die Grippeimpfung gehören dazu. Auch Vorsorgeuntersuchungen wie die Darmkrebsvorsorge ab einem Alter von 35 Jahren wird von der Krankenversicherung nicht nur unterstützt, sondern durch Öffentlichkeitsarbeit und viel Werbung einem jedem empfohlen.
Auch die präventionsorientierte Zahnheilkunde gehört zu dieser Unterkategorie der Leistungen der Krankenversicherung.
Nach dem selben Prinzip unterstützt die Krankenversicherung die Früherkennung und Untersuchungen von bzw. auf verschiedenste Krankheiten. Besonders besonders häufige Krankheiten, sogenannte Volkskrankheiten geraten häufig unter die Lupe des untersuchenden Arztes. Befindet man sich in einer Risikogruppe, entscheidet der Arzt gemeinsam mit dem Patienten auf eigene Faust, ob eine Untersuchung notwendig ist, oder nicht.
Die Krankenversicherung gibt dazu nur die Rahmenbedingungen vor. Sie bezahlt beispielsweise die Darmkrebsvorsorgeuntersuchung für Patienten ab 35 Jahren und die Gebärmutterhalskrebsuntersuchung für Frauen ab 20 Jahren.
Durch verschärfende Faktoren wie deutliche Symptome oder eine familiäre Vorgeschichte („meine Eltern sind beide an Darmkrebs verstorben“) bezahlt die Krankenversicherung auch eine entsprechende Untersuchung jüngerer Patienten.
Prinzipiell solltest du dir merken: Ab dem 36. Lebensjahr hat jeder Pflichtversicherte ein Recht auf einen regelmäßigen Gesundheits-Check.
Dabei wird alle zwei Jahre auf Volkskrankheiten wie Diabetis Typ II, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder bestimmte Allergien getestet.
Nicht zuletzt ist eine Leistung der Krankenversicherung die Behandlung von Krankheiten. Dazu gehören Dienstleistungen wie die ärztliche oder zahnärztliche Behandlung, aber auch Sachleistungen wie die Krankenhausbehandlung, Arzneimittel, Verbandmittel und Heilmittel.
Arzneimittel sind Medikamente. Sie gibt es in Form von Tabletten, Salben, Zäpfchen oder Spritzen.
Heilmittel hingegen sind Mitel, die weder Arzneimittel, noch Hilfsmittel sind. Sie werden nicht über längere Zeit benutzt und müssen erneuert werden. Das beste Beispiel für Heilmittel sind Massagen und Behandlungen der Krankengymnastik. Zur Behandlung eines Rücken- oder Halswirbelsäulen Problems ist ein regelmäßiger, mehrfacher Besuch bei einem Physiotherapeuten notwendig. Eine Massage oder eine Behandlung hilft oft nur beim Chiropraktiker, der Gelenke durch ruckartige Bewegungen einrenkt. Dauerhaften Erfolg bei durch den Alltag verursachten Verspannungen erzielt man nur mit regelmäßiger Anwendung der Heilmittel.
Hilfsmittel sind beispielsweise Rollstühle, Hörgeräte oder Rollatoren. Theoretisch sind auch Brillen Hilfsmittel, die eine Person zum gesunden und beschwerdefreien Leben benötigt, aber die Krankenversicherung hält sich vollkommen aus der Finanzierung von Sehhilfen heraus. Aber auch eine Haushaltshilfe zählt zu den Hilfsmitteln: Muss eine alleinerziehende Mutter ins Krankenhaus, muss sich jemand um das Kind und den Haushalt kümmern. Diese Haushaltshilfe wird von der Krankenkasse finanziert.
Würde ein Mitarbeiter einer Firma für ein Jahr psychisch schwer erkranken, sodass er oder sie in einer Psychiatrie unterkommen muss, gibt es zwei nicht so passable Möglichkeiten: Der Arbeitgeber bezahlt das Entgelt weiterhin und wird arm dabei.
Oder der Erkrankte erhält kein weiteres Geld, da er nicht arbeitet, wird aber durch die Selbstbeteiligung am Klinikaufenthalt und den weiteren, laufenden Kosten wie Miete u.ä. arm. Beide Möglichkeiten sind menschenunwürdig und so spielt die Krankenversicherung hier eine Rolle:
Arbeitnehmer, die wegen einer Krankheit arbeitsunfähig sind und keine Lohnfortzahlung mehr erhalten, weil diese auf einen Zeitraum von 6 Wochen begrenzt ist, können Krankengeld erhalten.
Landwirte erhalten übrigens statt Krankengeld eine Betriebshilfe der landwirtschaftlichen Krankenkasse. Auch Saisonarbeiter werden von dieser Krankenversicherung unterstützt.
Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschutz
Nicht ohne Zuzahlungen und Selbstbeteiligung
So weit, so gut. Du bist nun bestens über die Leistungen der Krankenversicherung informiert. Aber das war noch lange nicht alles. Denn die gesetzliche Krankenversicherung bezahlt längst nicht alle dieser Leistungen vollständig.
Es gibt etliche Grenzen und Gesetze darüber, welchen Zuzahlungen zu leisten sind. Und darüber gebe ich dir hier einen Überblick. Jeder Pflichtversicherte leistet folgende Zuzahlungen:
- 10 % des Preises von Medikamenten, mindestens aber EUR 5,00 und maximal EUR 10,00
- EUR 10,00 pro Tag bei Krankenhausaufenthalten und Rehabilitationsmaßnahmen
- EUR 10,00 je Verordnung von Heilmitteln oder häuslicher Krankenpflege
- 10 % der Kosten von Heilmitteln oder häuslicher Krankenpflege
Die Zuzahlungen von EUR 10,00 pro Tag im Krankenhaus sind auf 28 Tage begrenzt. Auch die Zuzahlung von 10% der Kosten von Heilmitteln sind auf 28 Tage begrenzt.
Das Medikament Metformin für Diabetiker kostet EUR 15,00. Die Zuzahlung von 10% würde EUR 1,50 betragen. Die Zuzahlung des Versicherten beträgt allerdings EUR 5,00, weil das die mindest-Zuzahlung ist.
Das Medikament Thybon für Menschen ohne Schilddrüse kostet EUR 52,00. Die Zuzahlung beträgt EUR 5,20, weil dies 10 % des Preises sind, dabei aber gleichzeitig mehr als EUR 5,00 und weniger als EUR 10,00.
Die Krankengymnastik für die Behandlung eines Halswirbelsäulen-Syndroms kostet EUR 200,00 für 6 Behandlungen à 20 Minuten. Der Versicherte bezahlt EUR 10,00 für die Verordnung dieses Heilmittels und EUR 20,00 anteilige Kosten ( 10 %).
Die Belastungsgrenze bei der Krankenversicherung
Allgemein gilt bei allen Zuzahlungen, dass die Belastungsgrenze nicht überschritten werden darf.
Die jährlichen Zuzahlungen dürfen 2 % der Bruttoeinnahmen nicht überschreiten. Für chronisch Kranke mit
- Asthma bronchiale
- COPD (Raucherlunge)
- HIV, AIDS
- Diabetes mellitus Typ I
- Hashimoto Thyreoiditis
- Morbus Basedow
gilt eine Belastungsgrenze von 1%. Der Hintergrund davon ist: Menschen mit chronischen Krankheiten haben Aufwendungen, die die Krankenkasse nicht bezahlt.
Sie fahren womöglich in Selbsthilfegruppen, müssen sich speziell (und teurer) ernähren oder benötigen Vitaminpräparate, um gesund leben zu können. Dabei leistet die Krankenkasse gar nichts – bis auf dass die ermäßigte Belastungsgrenze existiert.
So werden chronisch Kranke zumindest teilweise entlastet.
Eine Auszubildende erleidet 2015 einen Autounfall und muss wegen einer komplizierten Operation und der Genesung vier Wochen im Krankenhaus bleiben. Ihre Zuzahlung beträgt EUR 10,00 pro Tag. Für 21 Tage macht das EUR 210,00 Eigenbeteiligung. Dazu kommen EUR 15,00 für drei Medikamente, die sie dazuzahlen muss und eine Eigenbeteiligung von EUR 20,00 für die Physiotherapie im Anschluss an ihren Klinikaufenthalt.
Insgesamt kommen Kosten in Höhe von EUR 245,00 auf sie zu. Da sie als Auszubildende aber nur EUR 8.800,00 in diesem Jahr eingenommen hat, schickt sie entsprechende Belege an ihre Krankenkasse.
Die Krankenkasse bestätigt ihr, dass die Belastungsgrenze von 2 % bei dem Einkommen der Auszubildenden bei EUR 176,00 liegt. Also bekommt sie EUR 69,00 Anfang 2016 zurücküberwiesen.
Wenn der Versicherte bereits einmal über die eigene Belastungsgrenze von 1 oder 2 % gekommen und von ihrer Krankenversicherung eine Erstattung erhalten haben, gibt es zwei Möglichkeiten: Für das folgende Jahr kann man
- eine Befreiungskarte erhalten und die Zuzahlung von vornerein an die Krankenkasse zahlen
- Belege sammeln und sie am Ende des Jahres einreichen.
Das funktioniert natürlich nur, wenn man für das entsprechende Jahr erwartet, dass
- ähnlich hohe Kosten für Zuzahlungen entstehen, z.B. bei chronischen Krankheiten
- ein ähnlich hohes Einkommen erzielt wird, z.B. in der Ausbildung.
Was ist mit der privaten Krankenversicherung?
Ich bin zwar schon auf die Träger der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung eingegangen, aber habe noch nichts zur privaten Krankenversicherung allgemein geschrieben. Allgemein gilt in erster Linie: Die private Krankenversicherung gehört nicht zur Sozialversicherung.
Sozial bedeutet, dass die Armen und Schwachen gestärkt werden. Das ist bei der Privaten Krankenversicherung nicht der Fall.
Es gibt bei der privaten Krankenversicherung keine Umschichtung aus sozialen Gründen. Die Beiträge sind für junge, gesunde Menschen niedriger als für alte Menschen. Theoretisch können die Beiträge unbegrenzt steigen, da es keine Beitragsbemessungsgrenze gibt.
Die Beiträge zur privaten Krankenversicherung bestehen aus drei Teilen.
- Der Risikoanteil dient dabei der Finanzierung der Krankheitskosten.
- Der Verwaltungskostenanteil soll die Kosten und die Margen des Versicherungsunternehmens decken.
- Der Sparanteil sorgt dafür, dass die Beiträge im Alter nicht zu stark ansteigen.
Dass die Beiträge zu privaten Krankenversicherung gänzlich stabil bleiben, ist nicht zu erwarten, da die Lebenserwartung der Menschen immer weiter steigt und auch der medizinische Fortschritt immer mehr fortschreitet. Auch ist der demografische Wandel in Deutschland ein Faktor, weshalb die private Krankenversicherung mit steigendem Alter immer teurer wird und auch in jungen Jahren – siehe Sparanteil – jährlich höhere Beiträge mit sich bringen kann.
Einer der größten Unterschiede zur gesetzlichen Krankenversicherung ist, dass der Leistungsumfang des Versicherten selbst bestimmbar ist. Man bezahlt für das, was man erhalten möchte.
Im Krankenhaus wird man wegen der höheren Sätze bevorzugt behandelt. Auch Facharzttermine kriegen privat Versicherte einige Wochen (früher sogar Monate) früher als gesetzlich Versicherte.
Hat man sich einmal für die private Krankenversicherung (beispielsweise wegen der Arbeitsentgeltgrenze oder einer Selbstständigkeit) entschieden, kann man in der Regel nicht mehr zurück in die gesetzliche Krankenversicherung wechseln. Unter bestimmten Voraussetzungen ist das möglich, wenn der Versicherte noch keine 55 Jahre alt ist!
Im Jahr 2014 hatten in Deutschland etwa 8,83 Mio. Menschen ( 11,0 % der Bevölkerung) eine private Krankenvollversicherung und wendeten hierfür 36 Milliarden Euro auf. Im Jahr 2002 waren es noch 7,9 Millionen Menschen gewesen.
Prüfungsrelevante Zusammenfassung zur Krankenversicherung
Die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung sind
- AOK
- BARMER GEK
- BKK Mobil Oil
- DAK Gesundheit
- Debeka BKK
- Deutsche BKK
- Knappschaft Bahn-See
- IKK classic
- pronova BKK
- R u V BKK
- Techniker Krankenkasse
Versicherungspflichtig sind grundsätzlich alle Arbeiter, Angestellte, Auszubildende und Arbeitslose. Es herrscht in Deutschland eine Versicherungspflicht: Niemand darf ohne Krankenversicherung hier leben! Kinder werden beispielsweise über die Eltern familienversichert.
Die Beiträge betragen 2016 14,6 % und werden von Arbeitnehmer und Arbeitgeber je zur Hälfte gezahlt. Der Zusatzbeitrag, der in etwa 1 % beträgt und von Krankenkasse zu Krankenkasse variiert, wird vom Arbeitnehmer allein getragen.
Zu den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung gehören
- Krankengeld
- Mutterschaftshilfe
- Zahlung von Arzneimitteln
- Zahlung von Hilfs- und Heilmitteln
- Früherkennung von Krankheiten
- Behandlung von Krankheiten
- Übernahme der Kosten für Kuren und Reha
Wenn Krankheitskosten in Folge eines Arbeitsunfalls oder eines Unfalls im Rahmen eines Schul- oder Universitätsbesuchs auftreten, ist die zuständige Versicherung nicht die Krankenversicherung, sondern die Unfallversicherung.