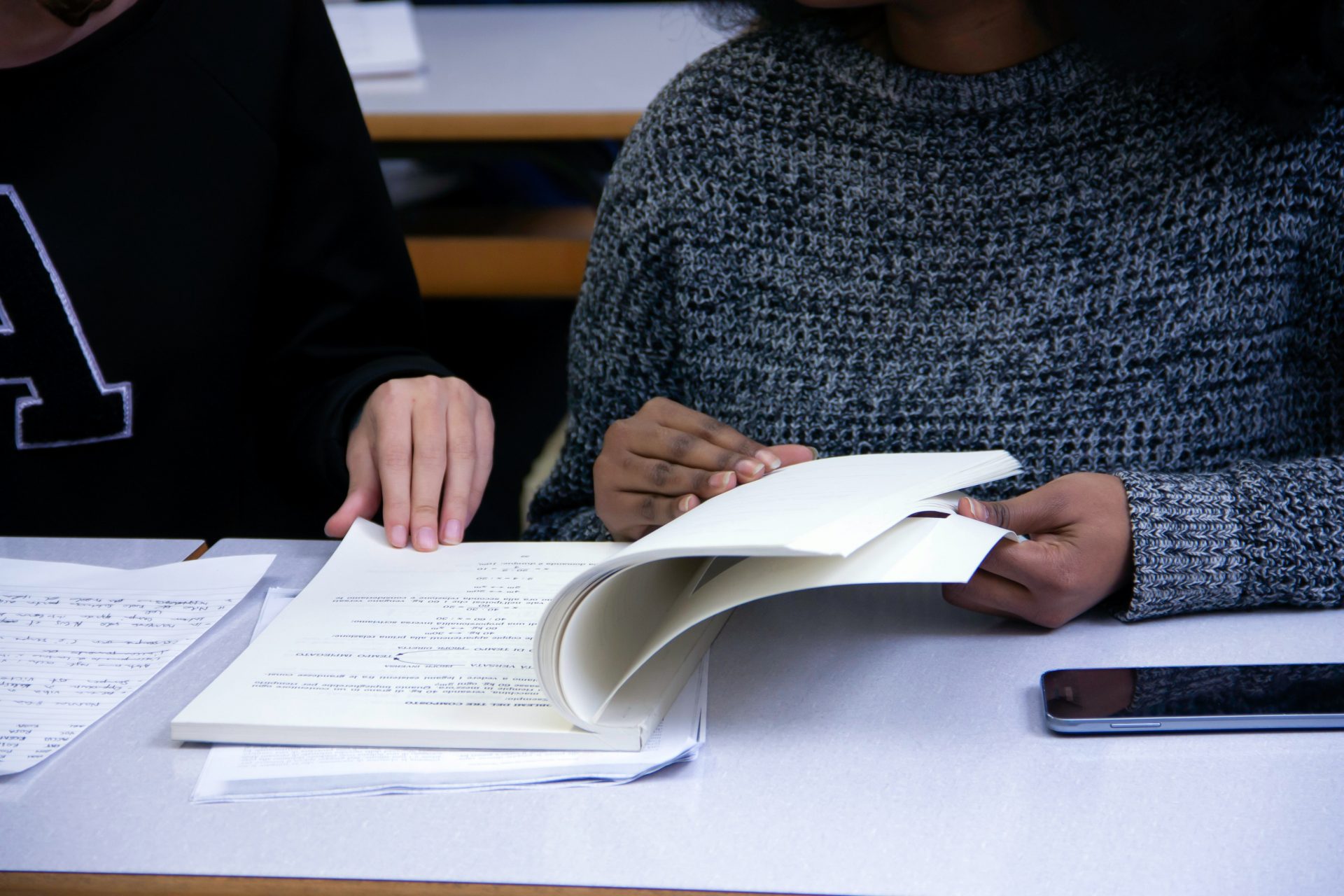Für die eigene Zukunft vorsorgen wird immer wichtiger. Dies sieht auch der Staat, weswegen er diese Art der Vorsorge in vielen Fällen unterstützt und steuerlich absetzbar macht. Dabei ist es notwendig zu wissen, welche Vorsorgeaufwendungen es gibt und wie diese im Einzelnen behandelt werden.
Welche Vorsorgeaufwendungen gibt es?
Grundsätzlich wird im Steuerrecht zwischen drei Arten an Vorsorgeaufwendungen unterschieden:
- die Altersvorsorge
- die Basisvorsorgeaufwendungen und
- andere Vorsorgeaufwendungen.
Unter die Altersvorsorge fallen Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung. Hierbei wird noch einmal in drei verschiedene Rentenarten unterscheiden:
Altersrente
Dies ist die häufigste Rentenart. Um einen Anspruch auf Altersrente zu erlangen muss jeweils ein bestimmtes Alter sowie eine Mindestanzahl an Versicherungsjahren erreicht sein. Ebenso sind neben der Regelaltersente noch vorgezogene Renten möglich:
- Altersrente für Frauen
- Altersrente für schwerbehinderte
- Altersrente für langjährige Versicherte
- Altersrente wegen Arbeitsteilzeit oder Arbeitslosigkeit
Die Altersteilzeit gehört jedoch nicht zu den unmittelbaren Rentenarten. Im Gegensatz zur Rente ist zeichnet sie den Übergang zwischen Arbeits- und Rentenleben aus. Um eine Rente nach Arbeitsteilzeit zu erhalten, müssen die Betroffenen vor 1952 geboren sein und mindestens 15 Jahre eingezahlt haben.
Erwerbminderungsrente
Wird das Rentenalter aus gesundheitlichen Gründen nicht erreicht und ist die betroffene Person nicht mehr in der Lage einer beruflichen Tätigkeit nachzugehen, greift die Erwerbsminderungsrente. Hierbei wird nochmals in teilweise und volle Erwerbsminderung unterschieden.
Kann der Tätigkeit noch zwischen drei und sechs Stunden nachgegangen werden, liegt eine teilweise Erwerbsminderung vor. Bei unter drei Stunden greift die volle Erwerbsminderung.
Dabei ist zu beachten, dass alle vor 1961 geborenen Personen Anspruch auf Berufsunfähigkeitsrente haben. Der Unterschied beider Rentenarten liegt unter anderem darin, dass die Rente zur Berufsunfähigkeit bereits gezahlt wird, wenn dem gelernten Beruf nicht mehr nachgegangen werden kann.
Um die Erwerbminderungsrente zu erhalten, darf die betreffende Person jedoch nicht mehr in der Lage sein, auch andere, einfachere Arbeiten zu verrichten. Zudem ist zu berücksichtigen, dass je nachdem ob diese Rentenformen privat oder gesetzlich in Anspruch genommen werden, unterschiedliche Voraussetzungen zum Erhalt des Geldes und auch Unterschiede in der Höhe der Bezüge anfallen.
Hinterbliebenenrente
Diese Rentenform sorgt für die Vorsorge der Angehörigen, im Falle des Todes des der betroffenen Person. Um anspruchsberechtigt zu sein, müssen zuvor mindestens fünf Jahre eingezahlt worden sein. Üblicherweise wird dabei in
- Witwen- bzw. Witwerrente
- Erziehungsrente und
- Waisenrente
unterschieden. Anspruch auf Witwenrente können neben Ehepartnern auch Partner aus Lebenspartnerschaften geltend machen. Hier existieren die kleine und die große Witwenrente.
Welche Rentenart gezahlt wird hängt davon ab, ob die notwendige Altersgrenze erreicht wurde, ob ein Kind vorhanden ist oder ob Erwerb- beziehungsweise Berufsunfähigkeitsrente gezahlt wird.
Erziehungsrente können Geschiedene erhalten, deren ehemaliger Ehe- oder Lebenspartner gestorben ist.
Als Voraussetzung muss die begünstigte Person verantwortlich für die Erziehung eines oder mehrere gemeinsamer Kinder sein. Zusätzlich darf keine neue Ehe oder Lebenspartnerschaft eingegangen worden sein und die fünfjährige Wartezeit bis zum Tode des ehemaligen Partners muss erfüllt sein.
Waisenrente wird je nach Verlust eines oder beider Elternteile als Halb- oder Vollwaisenrente ausgezahlt. Meist endet der Erhalt der Rente mit der Volljährigkeit. Ausnahmeregelungen können bestehen, wenn sich die Person zu dem Zeitpunkt in Ausbildung oder in einem freiwilligen ökologischen oder sozialen Jahr befindet.
Basisvorsorgeaufwendungen untergliedern sich in die Basisabsicherung im Krankheitsfall und die gesetzliche beziehungsweise private Pflegeversicherung.
Als sonstige Vorsorgeaufwendungen werden Beiträge zur
- Krankenversicherung
- Pflegeversicherung
- Arbeitslosenversicherung
- Risikolebensversicherung
- Erwerbsunfähigkeitsversicherung
- Berufsunfähigkeitsversicherung
- Altlebensversicherung
bezeichnet. Dabei handelt es sich bei den Vorsorgeaufwendungen zu Kranken-und Pflegeversicherung sowie zur Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung über Beiträge, die über die Basisabsicherung hinausgehen.
Damit werden einige Beitragsarten unterschiedlich behandelt, je nachdem welcher Gruppe der Vorsorgeaufwendung sie zugeordnet sind.
Unterschiede in der steuerlichen Behandlung gibt es auch in Abhängigkeit davon, ob die Versorgungsaufwendung als Betriebsausgabe oder Sonderausgabe gebucht werden können.
[sam id=“3″ codes=“true“]
Versorgungsaufwendung als Betriebsausgabe
In §4 Abs. 4 EStG ist definiert, was alles als Betriebsausgabe gewertet wird. Dazu gehören alle Aufwendungen, die durch den Betrieb veranlasst sind. Hierfür muss ein wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen der Aufwendung und dem Betrieb erkennbar sein.
Unterschieden wird in vier Arten von Betriebsausgaben:
- ausschließlich betriebsbedingte Ausgaben
- gemischte Aufwendungen
- sofort abzugsfähige Betriebsausgaben
- nicht oder nicht voll abziehbare Betriebsausgaben
Ausschließlich betriebsbedingte Ausgaben werden gewinnmindernd berücksichtigt.
Handelt es sich um gemischte Aufwendungen wie ein Dienstwagen, der auch privat genutzt wird oder um Telefonkosten, können diese zum Beispiel durch ein Fahrtenbuch oder Abrechnung der Telefoneinheiten in Betriebsausgaben und Lebensführungskosten getrennt werden.
Bei nicht so leicht trennbaren Kosten wie bei der Nutzung eines Laptops der privat und dienstlich genutzt wird, kann nur grob abgeschätzt werden, welcher Art die Ausgabe zugerechnet wird. Wird der Laptop nur hin und wieder privat genutzt, ist der private Anteil von untergeordneter Bedeutung und die Ausgaben werden voll den Betriebsausgaben zugerechnet.
Wird der Laptop jedoch nur hin und wieder für berufliche Zwecke verwendet, sind die Ausgaben der privaten Lebensführung zuzuschreiben.
Weiterhin gibt es die sofort abzugsfähigen Betriebsausgaben. Dazu zählen alle laufenden Ausgaben wie:
- Miete
- Personalkosten
- Zinsen
- Versicherungsbeiträge
- betriebliche Steuern
- Erwerb von Umlaufvermögen
Die Vorsorgeaufwendungen, die als Betriebskosten absetzbar sind, fallen mit in den Bereich der Personalkosten. Dazu gehören die Basisvorsorgeaufwendungen wie Pflege- und Krankenkassenbeiträge, die als Arbeitgeberanteil anfallen. Diese sind direkt an die Krankenkassen abzuführen.
Der Zeitpunkt des Abzugs dieser Ausgaben entscheidet sich dabei nach dem Abflussprinzip.
Ausnahmen, bei denen das Abflussprinzips keine Anwendung findet, führen zu nicht oder nicht voll abziehbaren Betriebsausgaben. Beispiele hierfür sind:
- Verlust
- Einlage von Wirtschaftsgütern
- Ausgaben für Anlagevermögen